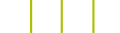In diesem Schuljahr ist erstmals die Reihe „Auf ein Wort – mit unserem Grundgesetz“ durchgeführt worden. Gemeinsam mit Antonia Stummvoll und Gregor Hanke, wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie der Universität Bayreuth, haben sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe elf mit verschiedenen Herausforderungen hinsichtlich der Grund- und Menschenrechte befasst und konkrete gegenwärtige Herausforderungen debattiert.
Die erste Veranstaltung ist im Fahrwasser der Debatte um eine Verschärfung der Migration und Integration gegangen. Der Anschlag in Aschaffenburg hat nachgewirkt und die Union unter Friedrich Merz hat einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der gesetzlichen Grundlage des Asylrechts eingebracht, wobei die Union und er bereit gewesen sind, zu tolerieren, dass die AfD diesem rechtlich fragwürdigen Vorschlag zustimmen würde. Die im Bundestag geführte scharfe Debatte ist im Anschluss an diesen Tabubruch auf Bundesebene in die öffentliche Diskussion übergegangen; von dieser Kontroversität ist auch die Veranstaltung geprägt gewesen.
In der Debatte haben beide Referenten auf die Menschen- und Grundrechte hingewiesen, vor allem darauf, dass das Asylrecht zwar verschärft werden könne, aber immer mit Blick auf die gegenwärtige Rechtslage, die abgeschlossenen internationalen Verträge und die Reichweite der Menschenrechte. Insofern ist man von Seiten der Rechtswissenschaft durchaus verwundert ob derjenigen Vorschläge, die gegen geltendes Recht auf Bundes- und EU-Ebene verstoßen würden.
Die zweite Veranstaltung hat sich mit den derzeitigen Herausforderungen der Meinungsfreiheit beschäftigt. So ist die Debatte darauf eingegangen, dass sich das Meinungsklima derzeit verändere: Auf der einen Seite greifen Hass und Hetze immer mehr um sich, vor allem anonymisiert in den sozialen Netzwerken, auf der anderen Seite stellt man fest, dass die Debattenkultur erheblichen Schaden genommen hat: Der Glaube daran, dass man nicht mehr alles sagen dürfe … Beide Referenten stellen schnell fest, dass man noch immer alles sagen dürfe, dass man aber nicht davon ausgehen könne, dass das Gesagte unkommentiert stehenbleiben würde. Die Meinungsfreiheit, so die beiden, garantiere, dass jeder alles sagen dürfe, es sei denn, das Gesagte erfülle den Tatbestand der Hetze und des Hasses. Insofern ist es der Wunsch dieser zweiten Veranstaltung gewesen, dass man zu einem faktenbasierten Austausch zurückkehren müsse.
Es ist ein gelungenes Veranstaltungsformat, welches den Schülerinnen und Schülern einerseits die Kontroversität der Auslegung der Grundrechte veranschaulicht, andererseits aber zeigt, dass der Boden unserer Wertordnung nicht verlassen werden darf.