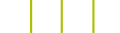Im Zuge der neuen Oberstufe und der damit einhergehenden Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler ein Planspiel zur EU durchführen sollen, hat der diesjährige Kurs ein Planspiel zur Flüchtlingskrise durchgeführt.
Gerade die Aktualität der Thematik und die damit einhergehende Debatte zeugen von Unsicherheit, von Sorgen und Ängsten. Gleichwohl sind Emotionen nicht unbedingt ein besonders guter Ratgeber hinsichtlich einer weitsichtigen, vor allem aber rechtssicheren Politik: Gerade die Tatsache, dass die aktuellen Flüchtlingszahlen nach unten gehen, dass GEAS – eine Reform der europäischen Migrationspolitik – im nächsten Kalenderjahr umgesetzt wird, gerade die Tatsache, dass alle Versuche, nationale Notlagen auf Basis des europäischen Rechts auszurufen, durch den Europäischen Gerichtshof gestoppt worden sind, gerade diese Tatsachen zeigen die Konfliktlinie der Debatte. Natürlich sind die Länder und Kommunen mit der aktuellen Situation überfordert, aber dennoch gilt es, sich an europäisches Recht zu halten – oder, so man anderer Meinung ist, aus den dem entsprechenden international verbindlichen Verträgen auszutreten.
Auf Basis dieser Konfliktlinie hat der Kurs eine Migrationskrise, vergleichbar der Krise aus den Jahren 2014/15, simuliert. Hierbei ist es darum gegangen, dass die Schülerinnen und Schüler im Europäischen Rat nach Lösungen einer fiktiven Migrationskrise suchen müssen; dabei übernahmen die Schülerinnen und Schüler Positionen der in der EU vertretenen Länder.
Schnell stellte sich heraus, dass die Lösung des Problems nicht nationalstaatlich gefunden werden könne. Der mögliche Bruch mit dem Schengener Abkommen – basierend auf der Möglichkeit der Wiederbelebung der innereuropäischen Grenzen und Grenzkontrollen – und damit der Bruch mit europäischem Recht schwebte über allen Debatten. So stellten Schülerinnen fest, die Griechenland, Italien und Frankreich vertraten, dass sie – auch auf Basis des Abkommens von Dublin – seit jeher mit den Flüchtlingen allein gelassen worden seien; gerade die Bilder aus Lampedusa, die Bilder aus Kreta bezeugen die bisweilen schwierige Umsetzung europäischer Migrationspolitik und die damit einhergehende Solidarität europäischer Staaten untereinander.
Auf der anderen Seite aber argumentierten Staaten wie Deutschland, die Niederlande, aber auch Ungarn, dass die Flüchtlinge dort registriert werden müssten, wo sie zuerst europäischen Boden betreten würden. Eine auf Basis der Dubliner Vereinbarungen zutreffende Einschätzung. Eine Leichtigkeit, bedenkt man, dass kein Flüchtling mit einem Flugzeug nach Deutschland kommt und infolgedessen dann zuerst deutschen Boden betritt, bedenkt man die Tatsache, dass kein Flüchtling durch das Mittelmeer und den Atlantik schwimmt, um dann in Hamburg aus der Elbe herauszusteigen …
Im Verlauf des Planspiels simulierten die Schülerinnen und Schüler mehrere Möglichkeiten. Unter anderem ist man auch auf die Möglichkeit eingegangen, Flüchtlinge in denjenigen Staaten unterzubringen, die Europa vorgelagert sind; recht schnell aber hat die Realität die Schülerinnen und Schüler eingeholt, denn Italien ist – hier mit Blick auf Albanien – des Öfteren diesbezüglich an den eigenen Gerichten gescheitert, da diese an die Menschenwürde sowie die Menschenrechte erinnerten.
Als die Schülerinnen und Schüler an den Punkt gelangten, dass sie einsehen mussten, dass die bisherigen Lösungen – u.a. mehr Gelder für die Staaten im Süden Europas zwecks Versorgung und Registrierung der Flüchtlinge vor Ort, u.a. die Notwendigkeit der Schaffung völkerrechtlich anerkannter Verträge mit den Staaten, welche die Flüchtlinge wieder aufnehmen müssten, u. a. die Tatsache, dass Menschenrechte weltweit gelten, zumindest in der Theorie – alle gescheitert waren, kam man zu dem Schluss, dass eine Lösung nicht möglich erscheint, folglich die Staaten zu kurzsichtig nationalen Maßnahmen griffen, darum wissend, dass diese Maßnahmen weder die Folge noch die Ursache der Migrationsherausforderung würde lösen können.
Die EU existierte am Ende des Planspiels nicht mehr!